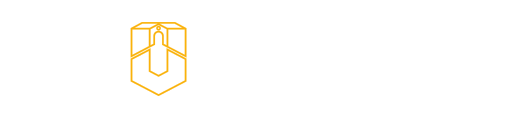Prüfungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Lehre. Die Gestaltung geeigneter Prüfungsformate erfordert ebenso sorgfältige Konzeption, Planung und Durchführung wie die Gestaltung der eigentlichen Lernsettings. Im Folgenden beziehen wir uns vorrangig auf Modul- und Abschlussprüfungen im Sinne von Leistungsnachweisen.
Funktionen von Prüfungen
Modul- und Abschlussprüfungen haben unterschiedliche Funktionen. Die wesentliche Funktion einer Prüfung ist die eines Diagnoseinstruments zur Bewertung von studentischen Leistungen. Man prüft also abschließend (nach Abschluss einer Lehrveranstaltung, eines Studienmoduls oder eines gesamten Studiums), ob die Studierenden zuvor festgelegte Leistungen erbringen können, meist in Form einer abgestuften Note. Man spricht hier von summativen Prüfungen (im Gegensatz zu formativen Prüfungen, die zur Unterstützung des vorangehenden Lernprozesses dienen).
Nicht zu vernachlässigen ist auch die Funktion der extrinsischen Lernmotivation. Man kann natürlich immer hoffen, dass Studierende auch aus einer intrinsischen Motivation heraus lernen, voraussetzen kann man dies aber sicher nicht bei allen Studierenden gleichermaßen. Insofern muss man sich als Prüfer:in darüber bewusst sein, dass man mit der Gestaltung einer Prüfung auch maßgeblichen Einfluss auf die Motivation (insbesondere die Leistungsmotivation) der Studierenden nimmt. Idealerweise stellt eine Prüfungsleistung für die Studierenden ein zwar anspruchsvolles, aber auf jeden Fall erreichbares Ziel dar. Ein wichtiger Begriff ist in diesem Zusammenhang die Selbstwirksamkeit. Studierende sollten also die Erwartung entwickeln und schließlich auch die Erfahrung machen, dass sie solche Herausforderungen wie eine Prüfung durch eigene Leistung und Anstrengung bewältigen können.
Als dritte Funktion einer Prüfung soll hier noch die Rückmeldung des Lehr-Lernerfolges genannt werden. Anhand von Prüfungsergebnissen können Studierende einschätzen, inwieweit ihre Lernstrategien, ihre Anstrengungen usw. erfolgreich waren und wie sie sich bei der nächsten Prüfung vielleicht noch besser vorbereiten können. Aber auch Sie als Lehrperson können aus den Prüfungsergebnissen ableiten, inwieweit Ihre Lernziele sinnvoll formuliert und kommuniziert wurden, wie gut Sie die Prüfung selbst gestaltet und durchgeführt haben und ob die von Ihnen gewählten und gestalteten Lehr-Lern-Settings dazu geeignet waren, die Studierenden auf die jeweilige Prüfung vorzubereiten.
Prüfung als Teil des Constructive Alignments
Constructive Alignment ist ein didaktisches Rahmenmodell für die Gestaltung von Lehre. Die Kernaussage dieses Modells besteht darin, dass Lernziele, Lehr-Lern-Settings und Prüfungen aufeinander abgestimmt sein sollten. Kurz gesagt: Sie sollten sich im Vorfeld genau überlegen,
- welche Lernziele sie erreichen möchten (welche Kompetenzen die Studierenden also neu erwerben oder weiterentwickeln sollen),
- wie Sie am besten prüfen können, ob und inwieweit die Studierenden diese Lernziele auch tatsächlich erreicht haben, und
- wie Sie die eigentliche Lehrveranstaltung so gestalten können, dass die Studierenden die Lernziele möglichst gut erreichen (gleichbedeutend mit einem möglichst guten Bestehen der Prüfung).
Eine gute, kompetenzorientierte Prüfung setzt also voraus, dass sowohl Sie als auch Ihre Studierenden genau wissen, welche Lernziele bzw. Lernergebnisse erreicht werden sollen, und dass alle Lehr- und Lernaktivitäten die Studierenden auch tatsächlich dabei unterstützen, diese Lernziele zu erreichen.
Kompetenzorientierung
Mit Kompetenzorientierung ist im Zusammenhang mit Prüfungen gemeint, dass insbesondere nicht nur das Vorhandensein reinen Fachwissens geprüft wird, sondern auch darüber hinaus gehende Fertigkeiten und Fähigkeiten, Motivationen, Einstellungen und Werte. Kompetenzen werden als latente Konstrukte verstanden, die nicht direkt beobachtet werden können. In diesem Sinne stellt eine studentische Prüfungsleistung eine beobachtbare Indikatorvariable dar, von der man auf die zugrunde liegenden Kompetenzen schließt. Eine Prüfung ist also unter anderem dann gut, wenn die Schlussfolgerung von der Prüfungsleistung auf die ihr zugrunde liegenden Kompetenzen objektiv, reliabel und valide möglich ist.
Anforderungen an Prüfungen
Eine Prüfung im Rahmen universitärer Lehre lässt sich als eine Messung verstehen, an die man dieselben Gütekriterien anlegen sollte wie an eine Messung im Rahmen wissenschaftlicher Forschung. Hier sind vor allem die oben bereits angesprochenen Hauptgütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität zu nennen.
Objektivität beschreibt hier das Ausmaß, in dem das Prüfungsergebnis unabhängig von der prüfenden Person und allgemein frei von Störeinflüssen ist. Bei der Durchführung einer Prüfung sowie bei der Festlegung einer Note sollte man sich also möglichst an Standards halten, die für alle geprüften Studierenden gleichermaßen gelten.
Mit Reliabilität ist die Zuverlässigkeit einer Prüfung gemeint. Das bedeutet, dass unter sonst gleichen Bedingungen (insbesondere bei vergleichbarer Leistungsfähigkeit der geprüften Person) auch immer im Wesentlichen das gleiche Prüfungsergebnis bzw. die gleiche Note herauskommen sollte. Eine Analogie hierzu ist ein Fieberthermometer, von dem man ja auch erwarten würde, dass es bei gleicher tatsächlicher Körpertemperatur im Wesentlichen immer wieder dieselbe Temperatur anzeigt.
Validität schließlich bedeutet, dass eine Prüfung auch tatsächlich das misst, was sie zu messen beansprucht. Eine Prüfung soll also dazu dienen, Rückschlüsse auf genau die Kompetenzen zu erlauben, die von den Studierenden erlangt oder entwickelt werden sollten. So sollte vermieden werden, unbeabsichtigt »sachfremde« Fähigkeiten und Fertigkeiten zu prüfen wie z. B. die Fähigkeit, in einer mündlichen Prüfung das Gespräch auf solche Themen zu lenken, die man gründlicher gelernt hat als andere, oder die Fähigkeit, gute Prompts für eine generative KI zu formulieren. Zur Validität gehört auch, dass man die Lernziele möglichst vollständig erfasst und sich nicht auf einige wenige beschränkt. Umgekehrt sollten Sie natürlich auch nur solche Kompetenzen prüfen, für die Sie ein Lernziel formuliert haben, und vom Prüfungsstoff nicht darüber hinaus gehen. Eine Prüfung ist weiterhin dann valide, wenn sie dazu geeignet ist, die Prüfungsleistung auf dem beabsichtigen Niveau zu erfassen. Wenn Sie also beispielsweise prüfen möchten, ob die Studierenden einen bestimmten Sachverhalt auch wirklich verstanden haben, muss die Prüfungsaufgabe so gestaltet sein, dass sie nicht durch bloßen Auswendiglernen bewältigt werden kann.
Über diese Hauptgütekriterien hinaus lassen sich noch weitere Anforderungen formulieren.
So sollte eine Prüfung für alle Beteiligten ökonomisch gestaltet sein, also vom Vorbereitungs-, Durchführungs- und Auswertungsaufwand sowohl für Sie als auch für die Studierenden mit vertretbarem Aufwand leistbar sein.
Auch Transparenz gehört zu den Anforderungen an eine Prüfung. Dazu gehört vor allem, dass den Studierenden die Lernziele und Prüfungsanforderungen von Beginn an bekannt sind.
Als weiteres Beispiel für eine Anforderung sei hier abschließend noch die Fairness genannt. Damit ist gemeint, dass Regeln für alle gleichermaßen gelten sollen und gleiche Prüfungsleistungen auch gleichermaßen anerkannt werden sollten. Hier bestehen direkte Bezüge zum oben dargestellten Hauptgütekriterium der Objektivität.
Bezugsnormen
Die Bewertung einer Prüfungsleistung kann anhand verschiedener Bezugsnormen erfolgen.
In aller Regel legt man bei einer Prüfung eine sachliche Bezugsnorm (auch kriteriumsorientierte Bezugsnorm genannt) zugrunde. Damit ist gemeint, dass die Beurteilung einer Prüfungsleistung relativ zu vorher festgelegten Kriterien und Standards erfolgt. Dies entspricht auch der Logik des Constructive Alignments: Die zu erreichenden Lernziele werden vorher aus sachlichen Erwägungen heraus festgelegt, und die Prüfung dient dazu, festzustellen, inwieweit die Studierenden diese Lernziele erreicht haben. Eine sachliche Bezugsnorm ist also besonders gut für Prüfungen geeignet, die eine Diagnosefunktion haben.
Darüber hinaus lässt sich eine Prüfungsleistung aber auch anhand einer sozialen Bezugsnorm bewerten. Hier erfolgt die Beurteilung relativ zu einer Vergleichsgruppe. Eine soziale Bezugsnorm wird beispielsweise dann zugrunde gelegt, wenn es um die Selektion oder Rekrutierung von Personen geht. Im Rahmen von Lehre und Studium wird eine soziale Bezugsnorm aber beispielsweise auch bei Notenspiegeln adressiert: Wenn man seine eigene Note kennt, kann man anhand eines Notenspiegels einschätzen bzw. berechnen, wie gut man im Vergleich zu allen anderen abgeschnitten hat, die dieselbe Prüfung absolviert haben. Es ist auch möglich, den Studierenden ihren Prozentrang (bezogen z. B. auf die Punktzahl in einer Klausur) mitzuteilen, also den Prozentsatz derjenigen, die ein schlechteres Ergebnis erzielt haben.
Schließlich kann man eine individuelle Bezugsnorm zugrunde legen, eine Prüfungsleistung also relativ zu früheren Leistungen derselben Person beurteilen. Dies kann beispielsweise durch Lerntagebüchern oder Lernportfolios realisiert werden. Die Studierenden haben hier die Möglichkeit, ihren persönlichen Lernfortschritt nachzuvollziehen, was für die Lernmotivation günstig sein kann und die oben bereits erwähnte Überzeugung von Selbstwirksamkeit zu entwickeln.
Konkrete Prüfungsformen und Aufgaben
Bei der Gestaltung Ihrer Prüfungen sind Sie an die Prüfungsordnung Ihres Studiengangs sowie an die jeweilige Modulbeschreibung gebunden, in denen genaue Vorgaben zu den vorgesehenen Prüfungsformen gemacht werden. Was die allgemeine Prüfungsform (Klausur, Hausarbeit, mündliche Prüfung, Referat) betrifft, haben Sie also wahrscheinlich wenig Spielraum. Wenn für Ihr Modul eine Klausur vorgegeben ist, können Sie sich darüber nicht einfach hinwegsetzen und stattdessen eine mündliche Prüfung durchführen, auch wenn dies besser dazu geeignet sein mag, das Erreichen der Lernziele zu überprüfen.
Innerhalb einer jeden Prüfungsform haben Sie aber durchaus Möglichkeiten, die konkrete Prüfung so zu gestalten, wie dies im Rahmen Ihrer Überlegungen (z. B. unter Berücksichtigung der Prinzipien des Constructive Alignments) sinnvoll ist. Die wesentliche Leitfrage für konkrete Entscheidungen bezüglich der Gestaltung von Prüfungen oder einzelnen Prüfungsaufgaben lautet:
Wie muss die Prüfung/Aufgabe aussehen, um zu überprüfen, inwieweit die Studierenden die einzelnen Lernziele der Veranstaltung/des Studienmoduls erreicht haben?
Sofern die Lernziele sorgfältig und kompetenzorientiert formuliert sind, lassen sich daraus oft schon konkrete Aufgaben ableiten, z. B.:
| Lernziel | Mögliche Aufgaben (z. B. in einer Klausur) |
|---|---|
| Die Studierenden sollen sämtliche Phasen des Modells XY nennen und ausführlich erläutern können. | Nennen Sie sämtliche Phasen des Modells XY. Erläutern Sie jede Phase ausführlich. |
| Ergänzen und erläutern Sie die zwei in der folgenden Abbildung fehlenden Phasen des Modells XY. | |
| Bringen Sie die im Folgenden aufgelistete Phasen des Modells XY in die korrekte Reihenfolge. | |
| Die Studierenden sollen das Modell XY auf konkrete Fälle und Beispiele anwenden können. | Ordnen Sie die folgenden Beispiele den Phasen des Modells XY zu. Begründen Sie jeweils kurz Ihre Zuordnung. |
| Erläutern Sie das folgende Beispiel unter Bezug auf das Modell XY. |
Achten Sie darauf, dass die Aufgaben vom Anspruch her zu den Lernzielen passen. Wenn ein Lernziel beispielsweise lediglich darin besteht, bestimmte Sachinhalte wiederzugeben, sollte eine dazugehörige Aufgabe von den Studierenden keine darüber hinaus gehenden Kompetenzen wie Verständnis, Anwendung oder Beurteilung erfordern.
Berücksichtigen Sie auch etwaige Bedingungen, die Sie in Ihren Lernzielen formuliert haben. Wenn ein Lernziel z. B. vorgibt, dass bestimmte Team-Arbeitstechniken entwickelt werden sollen, dann sollten Sie überlegen, ob nicht auch die Prüfung dieser Kompetenzen in Form einer Gruppenprüfung absolviert werden könnte.
Kompetenzorientierte Prüfungen
Eine umfassende Einführung zu kompetenzorientierten Prüfungen erhalten Sie in dem Gastvortrag von Katrin Wanninger & Anna Maria Engel vom Learning Center der Hochschule Osnabrück, der am 26.01.2023 in der Ideenpool-Vortragsreihe aufgezeichnet wurde (Link zum Gesamtvortrag Kompetenzorientiert Prüfen).
Im Folgenden finden Sie Ausschnitte des Vortrags zur leichteren Orientierung aufbereitet.
Theoretische Grundlagen und Begriffserklärungen zu Kompetenzen
Die theoretischen Grundlagen und Begriffe zur Kompetenzorientierung werden in der Vortragsaufzeichnung ab Minute 11:52 erläutert.
- Kompetenzorientierung (12:00)
- Lernzieltaxonomie (18:56)
- Constructive Alignment (25:20)
Checkliste zur Erstellung von kompetenzorientierten Prüfungen
Mit der Checkliste von Anna Maria Engel und Katrin Wanninger können Sie kompetenzorientierte Prüfungen Schritt für Schritt planen.
Prüfungsformat
Leitfragen
- Welches Prüfungsformat ist rechtlich und praktisch möglich (vgl. Allgemeine Prüfungsordnung & Rahmenbedingungen an der Hochschule)?
- Welches Prüfungsformat ist am besten dazu geeignet, um Lernziele zu überprüfen und Kompetenzen sichtbar zu machen (z.B. hinsichtlich Anwendungsbezug, Realitätsnähe, Transferausmaß)?
Schritte bei der Wahl des geeigneten Prüfungsformats
1 Wahl des Prüfungstyps
- rechtliche Erfordernisse berücksichtigen
- Aktuelle Allgemeine Prüfungsordnungen als rechtliche Grundlage
2 Wahl des Prüfungsformats
- Studienordnung und Modulbeschreibungen als Grundlage
3 Wahl des Prüfungsszenarios
- Spezifische Umsetzungsmöglichkeiten
- Insbesondere technische Umsetzungsmöglichkeiten berücksichtigen
- Machbarkeit prüfen
Die einzelnen Schritte werden in dieser Vortragsaufzeichnung ab Minute 28:35 erläutert.
- Prüfungsformate / Kompetenzen prüfen (28:55)
- Prüfungstypen (34:40)
- Prüfungsszenario (41:06)
- Prüfungsformate: Entscheidungshilfe (44:10)
Prüfungsaufgaben
Leitfragen
- Welche Aufgaben sind am besten dazu geeignet, um Lernziele zu überprüfen und Kompetenzen sichtbar zu machen?
- Inwieweit sollen und können im Rahmen der Aufgabe kontextfreie oder kontextbezogene Anforderungen realisiert werden?
- Wie viele Lösungsschritte bzw. –elemente sind erforderlich?
- Welche Freiheitsgrade sollen in der Ausgangssituation, den Lösungswegen und den Zielkriterien gegeben sein?
- Wie viele Aufgaben soll es insgesamt geben? Wie viel Zeit sollen die Aufgaben jeweils beanspruchen? In welchem Verhältnis stehen die enthaltenen Aufgaben zueinander?
Schritte bei der Erstellung kompetenzorientierter & lernzielgerechter Prüfungsaufgaben
1 Lernziel
- Aus dem Lernziel die Anforderungen der Aufgabe ableiten
- Lernzieltaxonomie heranziehen
2 Kontextbezug
- analysieren, inwieweit im Rahmen der Aufgabe kontextfreie oder kontextbezogene Anforderungen realisiert werden sollen (Realitätsnähe und Transfer)
3 Komplexität der Aufgabe
- bestimmen, wie viele Lösungsschritte/-elemente erforderlich sind
4 Offenheit der Aufgabe
- Freiheitsgrade der Ausgangssituation, der Lösungswege oder der Zielkriterien bestimmen
5 Zusammenführung aller Aufgaben
- Anzahl der Aufgaben, Zeit pro Aufgabe, Verhältnis der Aufgabentypen zueinander bestimmen
Die einzelnen Schritte werden in dieser Vortragsaufzeichnung ab Minute 45:43 erläutert:
- Prüfungsaufgaben (45:43)
- Format Open Book (46:37)
- Kurzinfo: E-Prüfungsräume der Uni Osnabrück (47:30)
- Format Multiple Choice (49:40)
- Prüfungsaufgaben-Beispiele für verschiedene Kompetenzniveaus (50:02)
- Beispielaufgaben Open Book-Format (51:53)
- Beispielaufgaben Multiple Choice-Format (56:08)
- Prüfungsaufgaben: Entscheidungshilfe (59:45)
Prüfungsbewertung
Leitfragen
- Ist eine Aufschlüsselung der zu prüfenden Kompetenzen und eine Beschreibung der einzelnen Notenstufen möglich und leistbar?
- Bin ich bereit mein Bewertungsschema stetig weiterzuentwickeln?
Schritte bei der Erstellung eines kompetenzorientierten Bewertungsschemas
1 Einordnung der Leistungen
- Quantitativ: Anzahl richtig gelöster Aufgaben
- Qualitativ: qualitative Eigenschaften einer Prüfungsleistung
2 Vorhandensein der Kompetenzen
- möglichst genaue Aufschlüsselung der zu prüfenden Kompetenzen
- Teilkompetenzen als Indikatoren
3 Ausmaß der Kriterienerfüllung
- Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Bewertung und Ausprägung
- Beurteilungsraster, das zwischen Bewertungsstufen differenziert und diese deskriptiv ausformuliert
4 Stetige iterative Weiterentwicklung
- Basierend auf den Erfahrungen einer Prüfungsperiode
- Während des aktuell laufenden Bewertungsprozesses
- interindividueller Vergleich zwischen Studierenden (soziale Bezugsnorm) notwendig
Die einzelnen Schritte werden in dieser Vortragsaufzeichnung ab 01:01:05 erläutert:
- Gestaltung der Bewertung: Schwierigkeiten & Lösungsansätze (01:01:05)
- Beispiel Bewertungsschema (01:05:05)
Autorinnen: Katrin Wanninger & Anna Maria Engel, Learning Center der Hochschule Osnabrück